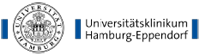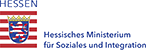Gewalt erkennen
Sie als Ärztin, Arzt, Pflege- oder Gesundheitsfachkraft können in Situationen kommen, in denen Sie nicht sicher sind, ob Menschen, die sie behandeln bzw. pflegen Gewalt erfahren haben.
Sprechen Patientinnen oder Patienten Gewalterfahrungen an, ist die Sachlage klar. Dies ist allerdings nicht häufig der Fall und besonders selten, wenn es sich um familiäre Gewalt oder Partnergewalt handelt. Abhängigkeitsverhältnisse erschweren eine klare Äußerung von Gewalterfahrungen. Angst, Scham oder Unsicherheit über die Folgen sind Gründe dafür, weshalb Patientinnen und Patienten eher den Sturz von der Treppe oder das Anstoßen gegen eine offen stehende Schranktür erfinden. Sie als Ärztin bzw. Arzt, Pflege- oder Gesundheitsfachkraft sind manchmal die einzigen Außenstehenden, an die sich Betroffene in dieser Situation Hilfe suchend wenden. Sie nehmen deshalb eine Schlüsselposition ein, wenn es darum geht, die Anzeichen von Gewalt zu erkennen und zu dokumentieren.
Da Gewalt jede Patientin und jeden Patienten, unabhängig von sozioökonomischen und soziodemografischen Faktoren, treffen kann, und die Aufdeckungsrate durch Gesundheitsfachkräfte nicht in einem adäquaten Verhältnis zur Prävalenz steht, wird in einigen Ländern (vor allem bei Patientinnen) ein generelles Screening nach Gewalterfahrungen empfohlen.
Warnsignale
Hagemann-White und Bohne (2003) haben Warnsignale („Red Flags“) beschrieben, die in der Gesundheitsversorgung Tätigen Hinweise geben können, an Gewalt als Ursache für Beschwerden zu denken. Sie sind im Zusammenhang mit Partnergewalt entwickelt, können aber auch auf andere Gewaltkontexte übertragen werden:
- Es liegen Verletzungen vor, die nicht mit der Erklärung übereinstimmen.
- Es kommt zu einer zeitlichen Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt der Verletzung bzw. dem Auftreten der Beschwerden und dem Aufsuchen der Gesundheitsversorgung.
- Die Patientin bzw. der Patient stellt sich wiederholt mit chronischen Beschwerden ohne erkennbare Ursache oder mit unklarem Beschwerdebild vor.
- Die Patientin bzw. der Patient ist in Begleitung einer Person, die nicht von der Seite weicht und kontrollierend ist; ebenso auffallend können übervorsorgliche Begleitungen sein.
- Die Patientin bzw. der Patient wirkt auffällig ängstlich und unsicher.
- Vereinbarte Termine werden nicht wahrgenommen. Die Schwangerschaftsvorsorge wird unregelmäßig oder gar nicht in Anspruch genommen.
Screening, aber wie?
Für eine systematische Erfassung von Gewalt wurden international verschiedene Fragen (Screening-Instrumente) entwickelt. In einem Health Technologie Assessment aus Großbritannien wurden u. a. solche Instrumente bei Partnergewalt in ihrer Güte bewertet (Feder et al. 2009). Prinzipiell valide Instrumente wurden auf ihre Tauglichkeit für die Gesundheitsversorgung in Deutschland überprüft, fünf wurden als geeignet identifiziert (Brzank, Blättner 2010). Nur eines der Instrumente ist auch deutschsprachig validiert, der „Partner Violence Screen“ (PVS).
Hofner et al. 2005 haben den PVS ins Französische übersetzt, auf interpersonelle Gewalt (alle Formen zwischenmenschlicher Gewalt) erweitert und damit eine Prävalenzstudie in einer Notaufnahme in Lausanne durchgeführt. Das Instrument besteht aus 4 Hauptfragen:
- Sind Sie von jemandem geschlagen, getreten, geboxt oder auf andere Art körperlich angegriffen worden?
- Sind Sie von jemandem bedroht, zu etwas gezwungen worden oder wurde Ihnen Angst gemacht?
- Fühlen Sie sich derzeit in Ihrem sozialen Umfeld und Ihrem Zuhause sicher?
- Hat Ihr aktuelles Anliegen etwas mit den oben genannten Umständen zu tun?
Nach sexualisierter Gewalt wird mit dem Instrument nur indirekt gefragt. Der körperliche Angriff oder die Frage nach Zwang kann sich darauf beziehen.
Speziell für die ambulante Pflege hat die Deutsche Hochschule der Polizei (2009) ein Instrument, das in Kanada erfolgreich für die Identifikation von Gewalt in Pflegebeziehungen genutzt wird, auf den deutschen Versorgungskontext übertragen. Das Instrument heißt „Verdachtsindex Misshandlung im Alter" (VIMA) und enthält fünf kurze Fragen zu körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt sowie Vernachlässigung und materieller Ausbeutung, die an die Pflegebedürftigen selbst gestellt werden. Zudem enthält er eine Frage nach der Fremdeinschätzung durch die Pflegefachkraft.
Evidenz von Screening
Evidenz im Sinne einer wissenschaftlichen Beweisführung für die Einführung einer generellen systematischen Befragung zu Gewalterfahrungen liegt derzeit nicht vor. Der Hauptgrund ist das Fehlen großer Studien, die den Sinn dieser Intervention zeigen könnten (Brzank, Blättner 2010 Feder et al. 2009).
Eine systematische Übersichtsarbeit (Taft et al. 2013) untersuchte den Nutzen von Screenings bei Partnergewalt. 11 Studien mit 13.027 Frauen konnten eingeschlossen werden. 6 Studien wiesen hohe Bias-Risiken auf. Die Kombination der Daten aus 6 Studien (n = 3564) zeigte, dass mit Screening mehr Gewaltopfer identifiziert werden können (RR 2,33; 95% CI 1,40 bis 3,89); vor allem im Rahmen der Betreuung von Schwangeren (RR 4,26, 95% CI 1,76 bis 10,31). Nur 3 Studien (n = 1400) untersuchten, ob sich durch das Screening die Anzahl der Empfehlungen an das Hilfesystem erhöht. Dafür sind zwar Hinweise vorhanden, aber aufgrund der geringen Fallzahlen ist ein Wirkungsnachweis nicht möglich. Nur 2 Studien untersuchten die Gewalterfahrungen der Frauen nach dem Screening, die eine nach 12, die andere nach 18 Monaten. Sie fanden keine signifikante Reduktion des Missbrauchs. Nur 1 Studie befasste sich mit möglichen negativen Auswirkungen und kommt zum Schluss, dass Screening nicht schaden kann. Die Studie zeigt eine Tendenz zu einem Nutzen für das psychische Wohlbefinden, die Ergebnisse sind aber nicht statistisch signifikant.
Die U.S. Preventive Services Task Force empfiehlt (Stand Oktober 2018), bei Frauen im gebärfähigen Alter ein Screening nach Partnergewalt durchzuführen und Betroffene an das Hilfesystem weiterzuvermitteln. Im Gegensatz dazu empfiehlt die Task Force ein generelles Screening von älteren und besonderes vulnerablen Erwachsenen nach Gewalt derzeit nicht, da derzeit noch keine hinreichenden Beweise für die Wirksamkeit solcher Maßnahmen gefunden werden konnte. Sie beziehen sich dafür auf eine Publikation von Feltner et al. 2018 in JAMA.